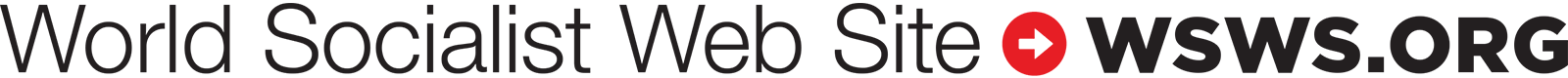Frankreich gehört neben Großbritannien, Deutschland und Australien zu den vier Ländern, die der US-Regierung in ihrem "Krieg gegen den Terrorismus" uneingeschränkte Unterstützung, einschließlich militärischer angeboten haben.
Zur Zeit befinden sich etwa 4000 französische Soldaten in Afrika und am persischen Golf, die sich aber bisher - zumindest offiziellen Angaben zufolge - nicht an den Kriegshandlungen gegen Afghanistan beteiligt haben. Lediglich zwei hochmoderne Schiffe, der Versorgungstanker Var und die Fregatte Courbet, wurden laut Außenminister Hubert Védrine bisher für den Krieg zur Verfügung gestellt. Eine direkte Beteiligung französischer Truppen an den Angriffen auf Afghanistan scheint auch wenig wahrscheinlich, da das Land weder über Kampfflugzeuge mit ausreichender Reichweite noch über entsprechende Marschflugkörper verfügt. Der einzige Flugzeugträger der französischen Marine, Charles de Gaulle, befindet sich zur Zeit in Revision.
Die Lage könnte sich aber ändern, falls der Krieg auf andere Länder wie Sudan, Somalia, Tansania oder den Jemen ausgedehnt wird. Sie lägen in der Reichweite der französischen Streitkräfte, die im ostafrikanischen Djibouti einen Stützpunkt mit 2.500 Soldaten und weitere Militärstützpunkte in Dakar, Libreville, Ndjamena und Abidjan unterhalten.
Wesentlich wichtiger als die Streitkräfte sind die französischen Geheimdienste für das gegenwärtige Kriegsgeschehen. Mehrere Dutzend Agenten des Auslands- und des Militärgeheimdienstes, der DGSE und der DRM, befinden sich im Land, wo sie eng mit der oppositionellen Nordallianz zusammenarbeiten. Deren kürzlich ermordeter Führer Schah Massud hatte im April dieses Jahres Paris besucht und die Zusammenarbeit vereinbart.
Die französischen Geheimdienste können in Afghanistan auf eine über zwanzigjährige Erfahrung zurückblicken. "Seit Ende der siebziger Jahre", schreibt die Zeitung Libération, "waren die Geheimdienste... stark an der Unterstützung der Mudjaheddin gegen die Sowjets beteiligt. Einer der großen Erfolge des Schwimmbeckens', der Spitzname der DGSE, bestand darin, dass sie als erste die sowjetische Invasion von 1979 ankündigte. Die französischen Agenten, die direkt ins Land infiltriert wurden oder unter Ausnutzung weniger achtbarer Methoden unter dem Deckmantel von NGOs arbeiteten, sind mit dem Land vertraut, besser jedenfalls als ihre amerikanischen Kollegen."
Spannungen zwischen Chirac und Jospin
Insbesondere der gaullistische Staatspräsident Jacques Chirac, der die Linie der Außenpolitik bestimmt und den Oberbefehl über die Streitkräfte ausübt, hat sich mit Solidaritätserklärungen und Unterstützungsangeboten an die amerikanische Regierung hervorgetan.
Er versicherte der US-Regierung zwei Tage nach dem Attentat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN der "totalen Solidarität" Frankreichs und besuchte am 18. September als einer der ersten ausländischen Staatschefs US-Präsident Bush in Washington. Am Abend des 7. Oktober, als die ersten Bomben auf Kabul fielen, kündigte er in einer feierlichen Fernsehansprache eine stärkere Beteiligung der französischen Streitkräfte an der Seite Amerikas an.
Aus dem Regierungslager, dem neben der Sozialistischen Partei von Regierungschef Lionel Jospin auch die Grünen und die Kommunistische Partei angehören, klingt die Unterstützung für die Politik der US-Regierung dagegen wesentlich verhaltener. Auch hier wird die "Solidarität im Kampf gegen den Terrorismus" betont, jedoch sofort an eine Reihe von Vorbehalten und Bedingungen geknüpft.
So verkündete Jospin in Paris, während Chirac noch in Washington weilte, dass eine militärische Beteiligung an der Seite der USA nur nach einem vorherigen Parlamentsvotum in Frage käme. Frankreichs Solidarität mit den USA bedeute keinen Verzicht auf eigenes Urteil und Souveränität. Und nach der Ansprache des Präsidenten vom 7. Oktober war aus der Umgebung des Premierministers zu hören, dieser sei erbost, dass Chirac seinem amerikanischen Amtskollegen eine "Blanko-Vollmacht" ausgestellt habe. Vor der Nationalversammlung warnte Jospin vor jeder "Verzahnung der Ereignisse" und betonte: "Wenn die Entwicklung in Afghanistan uns in einen Strudel ziehen sollte, in dem unsere Interessen unterzugehen drohen, dann bin ich nicht dabei."
Am vergangenen Mittwoch setzte sich Jospin in einer Rede vor dem Senat erneut deutlich von der Ausrichtung der US-Außenpolitik ab. Man müsse sich stets bewusst sein, betonte er, "dass es auf der Welt ungelöste Konflikte gibt, ein Elend und eine Enttäuschung der Völker besonders in der arabisch-muslimischen Welt, vielfache Ungleichheiten der Entwicklung, die, wenn wir nicht auf sie Acht geben, bewirken könnten, dass sich die radikalen, zerstörerischen Minderheitsbewegungen zusammenschließen, die lediglich durch den Hass auf andere und durch den Todestrieb motiviert sind."
Er sprach den Wunsch aus, "dass die Reaktionen in diesem Konflikt die Verhältnismäßigkeit zu den Zielen wahren. Wir wollen unsere Fähigkeit behalten, weiterhin im Dialog mit den arabischen Ländern zu bleiben, nicht nur mit den Führern, sondern auch mit anderen Meinungen." Die großen Themen der französischen Diplomatie, so Jospin, seien die Verminderung der Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, die Lösung der Probleme auf multilaterale statt auf unilaterale Weise, der Wille, in die vor sich gehende Globalisierung ein Bemühen um Regulierung und damit Organisierung zu tragen und - natürlich in engem Kontakt mit den europäischen Partnern - die Idee, dass Frankreich in internationalen Krisen weiterhin über eine eigene Botschaft verfüge.
Die unterschiedlichen Akzente von Chirac und Jospin sind zum Teil auf die Präsidentschaftswahlen vom kommenden Frühjahr zurückzuführen, bei denen sie voraussichtlich gegeneinander antreten werden. Mittlerweile entwickelt sich fast jede Frage der französischen Innen- und Außenpolitik zum Konfliktstoff zwischen den beiden Kontrahenten.
Während sich Chirac als souveräner Staatsmann gibt, der an der Seite von Bush, Blair und Schröder Verantwortung für das Weltgeschehen trägt, reagiert Jospin sensibler auf oppositionelle Stimmungen in der Bevölkerung. Gleichzeitig muss er auf Spannungen in der eignen Regierungskoalition und ständig sinkende Popularitätswerte Rücksicht nehmen. Seine beiden wichtigsten Koalitionspartner, die Grünen und die Kommunistische Partei, befinden sich angesichts des Kriegs in einer Zerreißprobe.
Die Grünen sind in der Kriegsfrage gespalten. Die Partei, die noch im März erfolgreich aus den Kommunalwahlen hervorgegangen und zur zweitstärksten Regierungspartei aufgerückt war, hat am Samstag ihren bereits ernannten Präsidentschaftskandidaten Alain Lipietz wieder aus dem Rennen gezogen, weil er in Meinungsumfragen nur noch zwei Prozent erreichte. Der Abstieg von Lipietz hatte lange vor dem 11. September begonnen, aber ausschlaggebend für seine Abwahl war schließlich ein Artikel in Le Monde, in dem er sich in lyrisch-sentimentaler Weise an die vorherrschende Kriegsstimmung anpasste.
Noël Mamère, der als Ersatz für Lipietz vorgesehen war, hat den Krieg dagegen mit den Worten verurteilt, es handle sich um einen "Kriegsakt gegen das afghanische Volk". Mamère lehnt inzwischen aber eine Kandidatur ebenfalls ab, so dass die Grünen völlig führungslos dastehen. Er begründet seine Ablehnung damit, dass er nicht Kandidat einer "balkanisierten", d.h. völlig gespaltenen Partei sein wolle.
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Robert Hue, bemüht sich zwar redlich, seine Partei hinter Jospin zu halten. Er lobt eifrig den "Sinn für Verantwortung, den die Autoritäten unseres Landes in dieser Angelegenheit bezeugen". Aber ein enges Zusammengehen mit der USA lässt sich in einer Partei, deren gesamte Mitgliedschaft durch den Kalten Krieg geprägt wurde, nur schwer durchsetzen. Hue sieht sich daher immer wieder zu Kritik an der US-Regierung gezwungen. Er sehe die "ernsthaften Gefahren einer unkontrollierten Spirale der Gewalt", kritisierte er den Afghanistan-Krieg. Der KPF-Abgeordnete Jean-Pierre Brard wurde noch deutlicher: "Es darf nicht so aussehen, als wäre Frankreich ein Anhängsel der Vereinigten Staaten, die die Entscheidungen für die gesamte Welt treffen", sagte er.
Strategische Differenzen
Die Spannungen zwischen Chirac und Jospin haben allerdings nicht nur innenpolitische Gründe, sie sind auch Ausdruck tiefgehender strategischer Differenzen innerhalb der herrschenden Elite Frankreichs.
In der umkämpften Region, dem Nahen und Mittleren Osten, verfolgt Frankreich seit langer Zeit massive politische und wirtschaftliche Interessen. Im 19. Jahrhundert beteiligte es sich nachdrücklich an der Ausplünderung und Aufteilung des Osmanischen Reiches, um schließlich nach dem Ersten Weltkrieg ein Kolonialmandat über Syrien einschließlich des Libanon zu übernehmen. Die engen wirtschaftlichen und finanziellen Verbindungen zu dieser Region sind bis heute nicht abgerissen. Der französischen Elite kann es daher nicht gleichgültig sein, wenn die USA in der Region militärisch aufmarschieren und einen Krieg vom Zaun brechen, dessen Ausmaß und Ende bisher nicht abzusehen ist. Dies umso weniger, als am Persischen Golf und in Zentralasien der größte Teil der erschlossenen und unerschlossenen Öl- und Gasreserven der Welt lagern.
Mit Hilfe des staatlichen Ölkonzerns Elf, der unter Präsident Mitterrand als eine Art zweites Außenministerium fungierte, verfolgt Frankreich seit längerem eigene Pläne bei der Erschließung der nahöstlichen und zentralasiatischen Energiequellen, die den britischen und amerikanischen Vorstellungen oft diametral entgegenlaufen. Dazu gehört zum Beispiel das Projekt einer Gaspipeline, das Zentralasien über den von den USA boykottierten Iran mit der Türkei verbindet.
Dass Frankreich im Krieg um Afghanistan nicht passiv beiseite stehen darf, ist daher in der herrschenden Klasse des Landes ziemlich unumstritten. Die Spannungen drehen sich um die Frage, mit welchen Mitteln der eigene Einfluss am besten geltend gemacht werden kann. Die bürgerliche Rechte, die in dieser Frage geschlossen hinter Chirac steht, sieht die einzige Chance in einer aktiven militärischen Beteiligung an der Seite der USA. Dem Chef der Liberalen, Alain Madelin, geht Chiracs diesbezügliche Haltung sogar nicht weit genug. "Unser bisheriger Beitrag", sagte er, "entspricht nicht dem Umfang der Bedrohung."
Jospin setzt dagegen, in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, stärker auf eigene Allianzen mit Teilen der Elite in der Region selbst. Die intensive Pendeldiplomatie fast aller europäischen Regierungen, das groteske Tauziehen um Einfluss auf die Nordallianz und den greisen Exkönig Zahir Schah, an dem sich Frankreich intensiv beteiligt, stehen in diesem Zusammenhang. Jede Regierung versucht, sich für die Zeit nach dem Krieg ihre eigenen Strohmänner in der Region zu sichern.
Auch ein Sechs-Punkte-Plan, den die französische Regierung am 2. Oktober als Beschlussvorlage für die anstehende Außenministerkonferenz der Europäischen Union vorlegte, verfolgt diesen Zweck. Lange bevor die ersten Bomben auf Afghanistan fielen, wurde darin ein Plan für den politischen Wiederaufbau nach der Vertreibung der Taliban entwickelt - unter Federführung der Vereinten Nationen und der EU, und nicht der USA!
Der Aktionsplan, der unter anderem humanitäre Hilfen und den Aufbau einer neuen politischen Struktur unter Aufsicht der Vereinten Nationen vorsieht, verfolgt laut der Zeitung Le Monde mehrere Ziele: "Europa wieder ins Spiel zu bringen, aus dem es (mit Ausnahme Großbritanniens) während der militärischen Phase der Krise ausgeschlossen war; den Eindruck zu vermeiden, die internationale Gemeinschaft sei bereit, Afghanistan zum Tummelplatz der Großen werden zu lassen; die Lösung der Krise in den Rahmen der UN zurückzubringen; darauf zu bestehen, dass die Afghanen ungeachtet der Absichten der Nachbarstaaten an der Bestimmung ihrer Zukunft beteiligt werden; der EU die Rolle zu geben, in der sie am erfahrensten ist, d.h. beim Wiederaufbau zu helfen."
Die europäischen Außenminister haben sich bisher allerdings nicht auf diesen Plan einigen können. Am Freitag soll er deshalb in einer stark reduzierten Form dem EU-Sondergipfel in Gent erneut vorgelegt werden.
Eine weitere Frage, die die französische Elite entzweit, ist die zukünftigen Haltung zu Europa. Der Anschlag auf das World Trade Center und der von den USA erklärte "Krieg gegen den Terror" haben die EU in einer denkbar ungünstigen Situation erwischt. Die Bemühungen um den wirtschaftlichen und politischen Zusammenschluss Europas haben zwar in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, aber die EU ist noch weit von einer gemeinsamen Außenpolitik, geschweige denn von gemeinsamen Streitkräften entfernt, mit denen sie ebenbürtig zu den USA auftreten könnte. Die erste, 60.000 Mann starke EU-Einsatztruppe soll frühestens Ende 2003 einsatzbereit sein - wird aber zur Zeit vom Nato-Mitglied Türkei mit Rückendeckung der USA blockiert.
Das Vorpreschen der britischen Regierung zu einem engen militärischen Bündnis mit den USA hat einer gemeinsamen europäischen Haltung von vornherein den Boden entzogen. Stattdessen bemüht sich jede europäische Regierung auf eigene Faust um bessere Beziehungen zur US-Regierung. "Wer ist der beste Freund der USA? Der Wettlauf der europäischen Staaten um die Gunst der Amerikaner entzweite in den vergangenen Wochen die Europäer aufs Neue", kommentiert dies Der Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe.
Vor allem von deutscher Seite hat dies erneute Bemühungen um eine beschleunigte Integration Europas ausgelöst. "Wenn wir getrennt bleiben, werden die Europäer in der neuen Weltordnung marginalisiert", zitiert Der Spiegel Außenminister Fischer. Bundeskanzler Schröder verkündete parallel dazu im Bundestag, die Etappe deutscher Nachkriegspolitik, in der sich Deutschland nur durch "sekundäre Hilfsleistungen" an internationalen Aktionen beteiligt habe, sei "unwiederbringlich vorbei". Deutschland werde sich "in einer neuen Weise der internationalen Verantwortung stellen, einer Verantwortung, die unserer Rolle als wichtiger europäischer und transatlantischer Partner, aber auch als starke Demokratie und starke Volkswirtschaft im Herzen Europas entspricht."
Solches Großmachtgetöse von der anderen Seite des Rheins ruft in Frankreichs Elite unweigerlich alte Ängste vor dem ehemaligen Kriegsgegner hervor. Das dürfte einer der Gründe sein, weshalb sich die bürgerliche Rechte einschließlich der traditionell US-kritischen Gaullisten eng an die USA anlehnen. Jospin dagegen hält an der Perspektive fest, Europa als Gegengewicht zu den USA zu entwickeln, und versucht dafür mit Appellen an die soziale und kulturelle Tradition auch Teile der ehemaligen Protestbewegung einzubinden. Langfristig wird der Gegensatz zwischen Europa und Amerika nur zu neuen und schärferen internationalen Zusammenstößen führen.